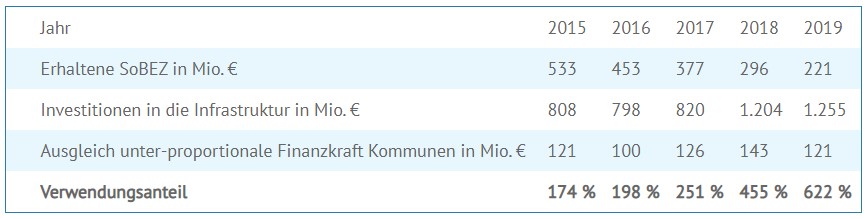Schwerin – Heute wurde in Schwerin die erste Studie zur Bedeutung der Digitalisierung für den Handel in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Das Energieministerium, auch zuständig für Digitalisierung und Landesentwicklung in M-V, hatte diese in Auftrag gegeben mit dem Ziel, verlässliche Aussagen über Bedeutung und Auswirkungen des Online-Handels für Handel und Kommunen vor Ort zu erhalten.
„Diese Aussagen brauchen wir, um mit den Partnern des Dialogforums Einzelhandel Strategien erarbeiten zu können, mit denen wir den stationären Einzelhandel als Kern lebendiger und zukunftsfähiger Innenstädte sichern. Die entscheidende Frage, die wir im Ergebnis dieser Studie beantworten müssen, lautet: Was können wir tun, um die Kunden in die stationären Läden zurückzuholen und die Online-Kaufkraft im Land zu binden?“, führte Minister Christian Pegel in die Pressekonferenz zur Studie ein.
Ihr Hauptbestandteil ist eine detaillierte, repräsentative Befragung von 4.215 Kunden in M-V im Sommer 2018 zu ihrem on- und offline Kaufverhalten. Diese hat unter anderem ergeben, dass etwas mehr als 90 Prozent der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft der Bevölkerung des Landes in den stationären Laden fließen. „Das spricht zunächst für ein gutes Einzelhandelsangebot und für eine hohe Zufriedenheit der Bevölkerung mit diesem. Das heißt aber auch, dass die Menschen im Nordosten gut eine Milliarde Euro jährlich für Online-Shopping ausgeben, Tendenz steigend“, fasste Pegel kurz zusammen.
Die detaillierten Ergebnisse der Studie stellte Michael Reink vor. „Das meiste Geld wird online in den Branchen ausgegeben, die für den Einzelhandel in den Innenstädten eine tragende Bedeutung haben: Bücher und Medien, Kleidung, Sport- und Freizeitartikel und Elektronik wie Computer, Fernseher, Handys“, führte der Bereichsleiter Standort- und Verkehrspolitik im Handelsverband Deutschland aus. Die Folge: „Es fließt weniger Geld in die Innenstädte. Knapp 40 Prozent der Befragten sagten, dass sie dank Online-Shopping seltener in die Innenstädte fahren“, so Reink.
Motive für den Online-Einkauf sind laut Befragung die bequeme Bestellung, Lieferung und Retoure, die große Auswahl von Produkten und – erst als Drittes – die Preise im Internet. „Auch, dass Produkte im Laden vor Ort nicht verfügbar sind, animiert viele Kunden ins Netz zu gehen“, so Reink. Dazu passe auch dieses Ergebnis der Studie: Je zufriedener die Kunden mit den stationären Läden, desto weniger kaufen sie online.
Auch online würden viele Kunden durchaus bei ihrem Händler vor Ort kaufen: Regionales Online-Shopping und Einkauf über einen regionalen Onlinemarktplatz halten viele der Befragten für relevant und nützlich – ebenso wie Online-Informationen der Händler über ihre Öffnungszeiten, Angebote, Veranstaltungen oder Warenverfügbarkeit. „Damit bestätigt sich die These, dass ein Händler, der nicht im Netz zu finden ist, wenig Zukunftschancen hat“, interpretierte Christian Pegel diese Ergebnisse.
Die Studie zeige aber auch, dass der Online-Handel nicht das Sterben des stationären Handels bedeutet: „Die Kunden kaufen gern in ihren Geschäften vor Ort ein, wenn das Angebot stimmt. Klar wird der Online-Handel weiter zunehmen. Wir können den Kunden nicht vorschreiben, wo sie einkaufen sollen. Aber gerade auch angesichts des steigenden Interesses für Klimaschutz und Nachhaltigkeit liegt hier eine große Chance für die Händler in unserem Land, mit guten On- und Offline-Konzepten Kunden an sich zu binden und so auch in der Zukunft gut aufgestellt zu sein“, sagt Christian Pegel und fügt hinzu: „Zugleich bietet die Digitalisierung Chancen, Angebotslücken durch Online-Angebote zu schließen und neue, alternative Versorgungsangebote zu entwickeln.“
Auf einen weiteren Aspekt des Online-Shopping-Angebots weist Kay-Uwe Teetz, Landesgeschäftsführer des Handelsverbands Nord hin: „Die Kunden bereiten heute viel häufiger als noch vor drei Jahren ihren Kauf im Laden online vor. Auf diese neue Realität müssen sich unsere Händler einstellen. Dafür brauchen sie innovative Geschäftskonzepte, die den Nerv des online-affinen und vor allem bequemen Kunden treffen. Sie brauchen qualifiziertes Personal, das Online-Verkaufskonzepte entwickeln kann und umsetzen kann. Deshalb ist es unbedingt notwendig, mehr E-Commerce Kaufleute auch für den stationären Handel auszubilden. Und wenn es um die Unternehmensnachfolge geht, muss mehr nach Lösungen für eine innovative Geschäftsanpassung gesucht werden, die dem Nachfolger nachvollziehbare Marktchancen eröffnen.“
„Der Handel belebt die Innenstädte und hält sie funktionsfähig. Geht es dem Handel gut, geht es vielen anderen Gewerbetreibenden gut. Stirbt der Handel vor Ort, sterben die Innenstädte“, sagt Matthias Belke, Präsident der IHK zu Schwerin und führte weiter aus: „Wir wollen die Kaufkraft vor Ort – in unseren Geschäften – binden. Gemeinsam müssen wir jetzt praktisch umsetzbare und zukunftsfähige Lösungen entwickeln.“
In der Studie werden bereits konkrete Lösungsansätze vorgeschlagen, um Online- wie stationären Handel mehr vor Ort zu binden. Dazu zählen zum Beispiel der flächendeckende Breitbandausbau, die Sicherung der Nahversorgung und die Verbesserung der Online-Sichtbarkeit der lokalen Händler.
„Der Breitbandausbau ist in vollem Gange. Und für die bessere Sichtbarkeit haben wir, beschleunigt durch Corona, einen landesweiten digitalen Marktplatz auf die Beine gestellt, auf dem Händler und Dienstleister aus ganz M-V sich präsentieren und ihre Produkte online verkaufen können. Mit unserem Portal https://marktplatz.digitalesmv.de geben wir dem Einzelhandel in M-V ein digitales Gesicht“, sagt Christian Pegel und: „Damit haben wir einen der wichtigsten Vorschläge aus der Studie bereits umgesetzt.“
Der Einzelhandel in M-V ist mit rund 50.000 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 8,5 Milliarden Euro jährlich – davon rund 25 Prozent durch Touristen – ein wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor im Land – und zudem die tragende Säule für lebendige und funktionierende Innenstädte und Tourismusorte.
Das „Dialogforum Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommern“ dient als Plattform für einen breit angelegten Informations- und Diskussionsaustausch zwischen Politik, Verwaltung, Handel, Land, Kommunen, Wissenschaft und Verbrauchern. Unter seinem Dach werden in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten Strategien entwickelt, um den Einzelhandel als Bestandteil lebendiger und zukunftsfähiger Innenstädte und Ortszentren zu sichern. Partner des Dialogforums sind neben dem Infrastrukturministerium die Industrie- und Handelskammern und der Städte-und Gemeindetag des Landes sowie der Handelsverband Nord und der Ostdeutsche Sparkassenverband. Mehr: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Raumordnung/dialogforum-einzelhandel/
Die Studie zur „Bedeutung der Digitalisierung für die Einzelhandels- und Versorgungsstruktur in Mecklenburg-Vorpommern“ wurde erarbeitet vom Institut für Handelsforschung aus Köln und der BBE Handelsberatung aus München. Sie wurde Ende 2019 abgeschlossen und Anfang 2020 im Landtag vorgestellt. Am 16. März 2020 sollte sie bei der alljährlichen „Handelsfachtagung MV“ den Händlern und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Veranstaltung musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.
Den größten Teil der Kosten für die Studie in Höhe von rund 200.000 Euro trägt das Infrastrukturministerium. Partner sind die IHK Schwerin und Rostock, der Handelsverband Nord und der Ostdeutsche Sparkassenverband.